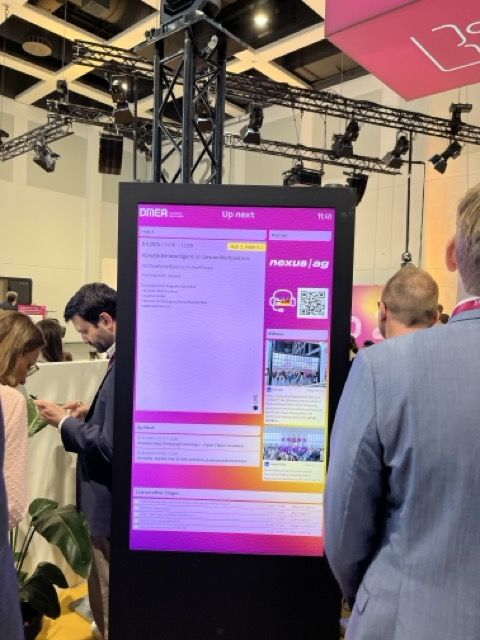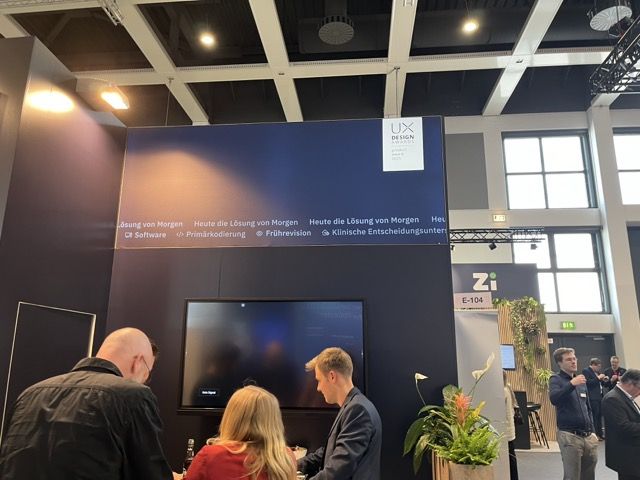Ein erstes wichtiges Thema war die Bundestagswahl 2025: "Gesundheits-IT nach der Wahl: Was kommt, was bleibt?" hieß die Session, die vom Bundesverband Gesundheits-IT (bvitg e.V.) organisiert wurde.
Speaker:innen waren Dr. Jens Baas (TK), Matthias Meierhofer (bvitg), Dr. Sibylle Steiner (KBV) und Sebastian Zilch (BGM). Es war allerdings erstaunlich (oder auch nicht), dass die Schlüsselwörter- und aussagen dieser 45 Minuten-Session ausschließlich im Konjunktiv blieben: man müsste mal, es sollte bedacht werden, wenn man so ein Projekt auf die Startbahn bringen will...und so weiter und so fort.
Würde man es nicht besser wissen, würde man die angesprochenen gesundheitspolitischen Projekte bestenfalls im frühen Planungsstadiumn vermuten. Dementsprechend ein eher entmutigender Auftakt.
Ein Programmhöhepunkt war die gewohnt lockere Keynote von Digital-Health-Urgestein und Gesundheitsökonom Dr. David Matusiewicz.
Matusiewicz beschrieb eine technologische Neuerung, die er als potenziellen "Gamechanger" im Gesundheitswesen betrachtet: einen neuen, extrem dünnen KI-Pin, der optisch einer Scheckkarte ähnelt. Im Gegensatz zu früheren KI-Anwendungen, die oft an hohem Stromverbrauch scheiterten (wie das erwähnte Beispiel des "Al-Pin"), soll dieser neue Pin durch einfaches Drücken ein Mikrofon aktivieren und über Stunden funktionieren.
Entscheidend ist die geplante Interoperabilität: Firmen wie MERS und andere Player sollen sicherstellen, dass die erfassten Daten automatisch in bestehende Systeme wie KIS (Krankenhausinformationssysteme) oder Praxisverwaltungssysteme integriert werden können.
Matusiewicz hebt hervor, dass diese Entwicklung KI "anfassbar" und praktisch nutzbar macht. Dies sei ein wichtiger Schritt, der auch die Akzeptanz bei Patienten fördern könnte (erwähnt wird die Vereinfachung von Zustimmungsprozessen). Er sieht darin die Möglichkeit, die seit 20 Jahren diskutierte Vision des "tastaturlosen Krankenhauses" endlich zu realisieren.
Abschließend verknüpft er diese Technologie mit seinem übergeordneten Thema der "Datenplattform Mensch" und zieht eine Parallele zu Fritz Kahns Konzept des "Menschen als Industriepalast", was eine Sichtweise auf den Menschen als komplexe, datenreiche Entität in der Medizin andeutet.
In der Session "Perspektiven junger Ärzte: Digitale Zukunft und Herausforderungen der Selbstständigkeit" diskutierten Dr. Johannes Eschrich (Board-certified Specialist in Internal Medicine bei Charité Universtiätsmedizin Berlin), Dr. Nicolas Kahl (Gründer und Praxisinhaber, Facharzt für Allgemeinmedizin bei Hausarztpraxis Fischbach), Ulrice Krüger (Praxisberatung bei Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG) und Oliver Reucher )Geschäftsführer GMG mbH bei Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein) .
Die ärztliche Karriereplanung unterliegt einem spürbaren Wandel. War früher der Weg in die eigene Praxis für viele der logische Schritt, sehen wir heute eine wachsende Präferenz für Angestelltenverhältnisse. Gründe dafür sind vielfältig – von finanziellen Einstiegsbarrieren bis zu komplexen regulatorischen Anforderungen. Doch während diese Herausforderungen die Niederlassung erschweren, eröffnen sich durch die Digitalisierung auch völlig neue Chancen: Prozesse können verschlankt, der Arbeitsalltag erleichtert und die Attraktivität der Selbstständigkeit potenziell gesteigert werden.
Ulrike Krüger, die als Praxisberaterin bei der ApoBank tätig ist und täglich mit Ärzten spricht, leitete die Diskussion ein. Sie betont die hohe Relevanz dieses Themas und beleuchtete verschiedene Perspektiven.
Um den Austausch anzuregen, stellt sie gezielte Fragen an die Runde, insbesondere an (mutmaßlich anwesende) niedergelassene Ärzte:
- Aktueller Stand: Wie digital sind die Praxen aufgestellt?
- Optimierungsbedarf: Wie hoch schätzen die Heilberufler selbst den Bedarf an Optimierungen ein (sie wirft die Zahl 63% in den Raum)?
- Administrativer Aufwand: Wie viel Zeit wird für Bürokratie aufgewendet (sie nennt 61 Stunden als Beispiel)?
- Wirtschaftliches Potenzial: Welches jährliche Einsparpotenzial (sie nennt 42 Milliarden Euro für Europa) könnte durch umfassende Digitalisierung im Gesundheitswesen gehoben werden?
Ausgehend von den Kernfragen, die von Frau Krüger angestoßen wurde, wurden wichtige quantitative Aspekte (Zeitaufwand, Einsparpotenzial) und qualitative Aspekte (Optimierungsbedarf) non den Diskutant:innen angesprochen, auch um die Dringlichkeit und die Chancen der Digitalisierung aus Sicht der Praxen zu verdeutlichen.
Digitale Kluft im Gesundheitswesen: Zwischen Fortschritt und Papierstau
In vielen Arztpraxen ist die Digitalisierung längst im Alltag angekommen – so sieht es Dr. Nicolas Kahl, der mithilfe digitaler Symptomchecker die Dringlichkeit von Patientenkontakten besser einschätzen kann. „Das gibt mir mehr Kontrolle über die Priorisierung“, erklärt er. Doch während die ambulante Versorgung Tempo aufnimmt, wird der Fortschritt durch strukturelle Hürden gebremst.
Ein zentrales Problem: die fehlende Synchronisation mit dem stationären Bereich. "Wir digitalisieren, aber aus den Kliniken kommen weiterhin Briefe – mit Laborergebnissen, die Monate alt sind", berichtet sie. Der mediale Bruch zwischen den Sektoren führe nicht nur zu Frust, sondern auch zu einem ineffizienten Einsatz ohnehin knapper Ressourcen. Ihr Appell ist klar: "Die Schnittstellen müssen nahtlos funktionieren. Nur dann kann Digitalisierung ihre volle Wirkung entfalten – und uns im Praxisalltag wirklich entlasten."
Tag 1 ist also auch ein wenig "the same old story", jetzt bin ich gespannt auf Tag 2.
ssey/bvdd